Oder: Wie kreative Methoden helfen, Gedanken zu ordnen – und Sinn zu finden.
Heute ist der 10. Oktober, heute ist World Mental Health Day, von der WHO in jedem Jahr erneut ausgerufen.
Und während überall über Politik, Wirtschaft und Krisen gesprochen wird, geht ein entscheidendes Thema oft unter: Wie all das eigentlich auf uns wirkt. Auf unser Nervensystem, unsere Beziehungen, unsere Fähigkeit, klar zu denken, zu fühlen und menschlich zu bleiben.
Wir haben uns daran gewöhnt, in einem Zustand von permanenter Anspannung zu leben. Krisen sind zum Dauerzustand geworden. Und das, was für uns schleichend immer mehr zum „normal“ wird, ist in Wahrheit ein totaler Alarmmodus.
Genau deshalb ist dieser Tag so wichtig.
Denn mentale Gesundheit ist kein Trend, kein Luxus, kein „Selfcare-nice-to-have“, sondern sie ist das Fundament, auf dem alles andere steht – auch die Menschlichkeit.
Die Krise draußen, die Krise drinnen
In diesem Jahr steht der World Mental Health Day unter dem Motto „Mental Health in Humanitarian Emergencies“. (Mentale Gesundheit in humanitären Krisen)
Das klingt erstmal weit weg – nach Kriegsgebieten, Flucht, Katastrophen. Aber wir alle wissen wohl, wie nah es doch eigentlich gerade ist. Ich selbst, als späte Millennial, hätte nicht gedacht, dass in meinem Leben eine Angst vor Krieg mal so eine große Rolle spielen könnte.
Und wer genau hinsieht, erkennt: Auch im Alltag, in unseren Wohnzimmern, Küchen, Büros, tragen so viele Menschen eine Art stille, unsichtbare Krise in sich.
Denn wenn die Welt draußen unsicher ist, steigt auch der Druck im Inneren.
Wir versuchen, zu funktionieren, während unser Nervensystem ganz laut nach Entlastung schreit. Wir rationalisieren, schieben Gefühle weg, erklären uns das Chaos „vernünftig“. Aber psychologisch betrachtet ist genau das der Punkt, an dem das System beginnt, zu überhitzen.
„Hurt people hurt people“ – wenn Überforderung ein Muster wird
Der Satz „hurt people hurt people“ begleitet mich schon eine ganze Weile und bringt es auf den Punkt:
Menschen, die verletzt sind, verletzen oft andere – nicht aus böser Absicht, sondern aus einem inneren Überlebensmodus heraus, unbedacht.
Unser Körper reagiert, bevor der Kopf rational versteht, was eigentlich los ist. Wenn wir überfordert sind, greifen wir unbewusst auf unsere alten, erlernten Schutzmechanismen zurück: Verdrängung, Projektion, Überanpassung, Kontrolle. Diese Strategien haben uns einmal geholfen, schwierige Situationen zu überstehen. Aber irgendwann werden sie dann selbst zur Belastung.
Das Resultat?
Reizbarkeit, emotionale Distanz, das Gefühl, innerlich leer zu sein. Wir spüren uns weniger – und dadurch auch andere. Der Kreislauf schließt sich: hurt people hurt people.
„Healing people heal people“ – wie Selbstregulation wirkt
Aber der Satz hat auch eine zweite Hälfte: „Healing people heal people“.
Das bedeutet nicht, perfekt zu sein oder nie wieder Fehler zu machen. Sondern sich selbst zu verstehen, um bewusster handeln zu können.
Psychologisch sprechen wir hier von Selbstregulation – der Fähigkeit, Gefühle wahrzunehmen, zu benennen und zu steuern, bevor sie die Kontrolle übernehmen.
Und das verändert dann alles: Du reagierst weniger automatisch. Du hast wieder Zugang zu Empathie. Du kannst Grenzen setzen, ohne Schuldgefühl.
Selbstregulation ist keine esoterische Idee, sondern eine messbar wirksame Fähigkeit. Studien zeigen, dass sie Stress reduziert, Resilienz stärkt und langfristig sogar körperliche Gesundheit verbessert.
Warum Kreativität auch in Krisen so wirkungsvoll ist
Ein Weg dorthin führt über Kreativität – nicht im Sinne von Kunst oder Perfektion, sondern als Form der inneren Selbstorganisation. Denn wenn du schreibst, zeichnest, collagierst oder einfach Gedanken zu Papier bringst, aktivierst du das Gehirn anders: Emotion und Kognition verbinden sich.
Psychologische Studien belegen:
Kreative Ausdrucksformen wie Journaling, freies Schreiben oder visuelle Arbeit können nachweislich helfen, Emotionen zu verarbeiten, Stress zu regulieren und das Gefühl von Selbstwirksamkeit zu stärken. Das Ziel ist dabei nie das perfekte Ergebnis, sondern das bewusste Wahrnehmen – das „Ich sehe mich selbst in diesem Prozess.“
Kreativität ist also kein Hobby, sondern eine Form mentaler Hygiene.
Meine Haltung – und was Coaching leisten kann
Ich glaube:
Verantwortung übernehmen beginnt da, wo wir aufhören, nur zu funktionieren.
In meinem Coaching geht es nicht um Motivation oder positive Sprüche. Sondern um das Verstehen der eigenen Muster. Um ehrliche Selbstreflexion, sanfte Konfrontation und echte Veränderung.
Ich arbeite mit Tools, die wissenschaftlich fundiert sind:
- Journaling-Methoden, um innere Prozesse sichtbar und verständlich zu machen.
- Visualisierungstechniken, die helfen, Gedanken und Gefühle greifbar zu machen – statt sie nur im Kopf kreisen zu lassen.
- Kreative Strategien, die neue neuronale Bahnen öffnen, statt alte Gedankenschleifen zu bedienen.
Denn Veränderung beginnt nicht im Kopf allein – sondern im Zusammenspiel von Denken, Fühlen und Tun.
Was jetzt zählt
Mentale Gesundheit ist kein Privileg. Sie ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Verantwortung – für sich selbst und für andere.
Wenn Menschen wieder klar denken und fühlen können, treffen sie bessere Entscheidungen. Privat, gesellschaftlich und menschlich.
Denn am Ende gilt:
„Hurt people hurt people.“
Aber auch:
„Healing people heal people.“
Und vielleicht ist genau das, was diese Welt gerade braucht – mehr Menschen, die sich trauen, bei sich selbst anzufangen.
Mentale Gesundheit ist kein „Nice-to-have“, sie ist Haltung. Und Haltung wächst, wenn wir anfangen, bewusster mit uns selbst umzugehen. Haltung erzeugt Haltung.
👉 Wie siehst du das? Schreibe mir einen Kommentar ⤵️, lass uns drüber diskutieren.
Wir leben in einer Zeit, in der mentale Stabilität keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Aber sie ist (wieder-) lernbar.
Ich arbeite systemisch – das heißt: alltagstauglich, wirksam und mit einem klaren Blick auf das, was dich wirklich stärkt.
👉 Wenn du wissen willst, wie das geht, folge mir auf Instagram oder melde dich für meinen Newsletter an. Direkt, authentisch und ohne Blabla.

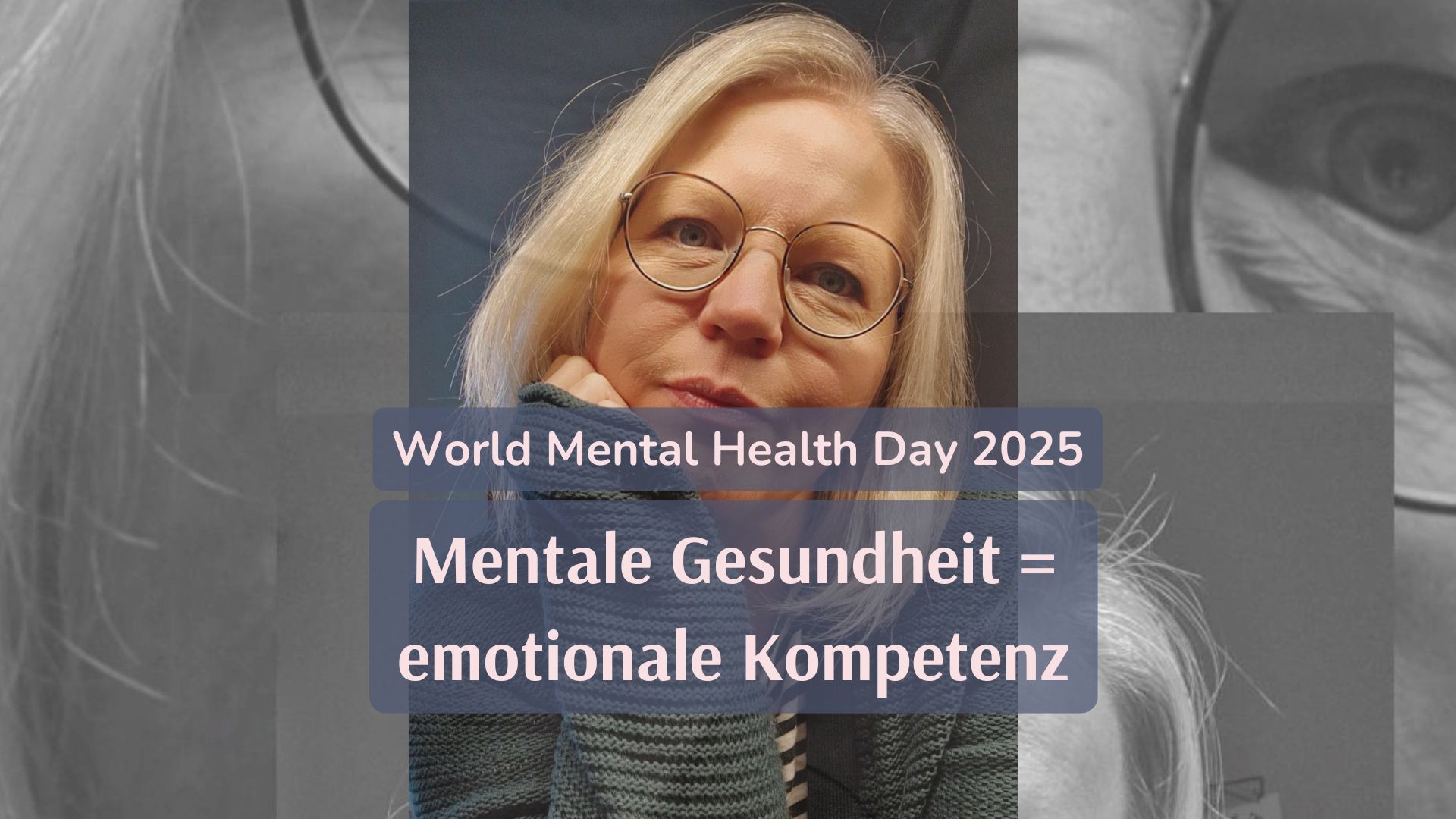
Schreibe einen Kommentar